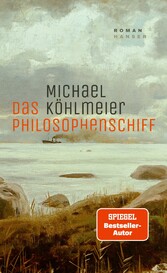
Das Philosophenschiff - Roman
von: Michael Köhlmeier
Carl Hanser Verlag München, 2024
ISBN: 9783446282377
Sprache: Deutsch
224 Seiten, Download: 2479 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Erstes Kapitel
Frau Professor Anouk Perleman-Jacob lernte ich an ihrem hundertsten Geburtstag kennen. Der Österreichische Ingenieur- und Architekten-Verein lud zu einem Abendessen ihr zu Ehren ins Palais Eschenbach im 1. Wiener Gemeindebezirk. Das war im Mai 2008.
Meine Einladung verdankte ich ihrem »ausdrücklichen Wunsch«. Ich möge die Geschichte von Dädalus erzählen; die habe sie im Radio gehört und wolle sie noch einmal hören, weil darin Dinge vorkämen, von denen sie nichts gewusst habe und von denen auch sonst niemand etwas wisse — sie habe bei ihren Freunden nachgefragt —, zum Beispiel, dass Dädalus ursprünglich Bildhauer, später Architekt und dann erst Erfinder gewesen sei. Das alles hatte mir der Präsident des Vereins, Herr Dr. Mahler, am Telefon mitgeteilt. Er klang, als wäre ihm die Sache unverständlich und unangenehm, und würde es nach ihm gehen, wäre keine Einladung an mich ausgesprochen worden. Seine Stimme war eintönig wie die eines Butlers, der vorsorglich jeden ihm unbekannten Besuch als verdächtig einstuft und verächtlich behandelt. Ich gab ihm recht — im Stillen —, auch mir war die Sache peinlich, denn gerade diese Geschichte hatte ich frei erfunden, hatte aber in meiner Radiosendung so getan, als wäre sie überlieferter Mythos.
Ich erzählte sie an diesem Abend dann doch nicht. Niemand forderte mich dazu auf. Ich war erleichtert, zugleich auch ärgerlich, ich war immerhin sieben Stunden mit dem Zug gefahren und würde noch einmal sieben Stunden zurückfahren. Ich wollte mich bei Gelegenheit davonschleichen. Vor dem Dessert kam ein junger Mann an meinen Tisch — ich war an den äußersten Rand des Saals platziert worden — und sagte, Frau Professor Perleman-Jacob wünsche, dass ich mich zu ihr setze.
Sie hörte nicht mehr gut und konnte nur noch schlecht sehen. Mit den anderen an ihrem Tisch sprach sie überlaut, mit fester, beinahe jugendlicher Stimme. Da waren neben dem Präsidenten des Vereins die Ministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, der Wiener Bürgermeister, der Leiter der Kulturabteilung der Stadt, der Vizekanzler der Republik und der russische Botschafter, dazu Gatte und Gattinnen, und dann noch eine Amerikanerin, eine — wie sie mir vorgestellt wurde — Freundin und Kollegin der Geehrten, die immer wieder nach ihrer Hand griff und sie drückte. Die Amerikanerin war es auch, die sich bei mir dafür entschuldigte, dass meine Erzählung aus dem Programm gestrichen worden war, eine Stimme wie ein Mann. Die Gefeierte höre inzwischen so schlecht, dass mein Auftritt nicht die gebührende Wirkung erfahren würde.
Frau Perleman-Jacob bat den Vizekanzler, der neben ihr saß, mir seinen Platz zu überlassen. Ich solle ihr »mein Ohr leihen«, damit meinte sie — sie winkte mich mit ihrem Zeigefinger zu sich —, ich solle mich zu ihr beugen. Es war mehr als merkwürdig: Flüsternd in strengem Ton befahl sie mir, amüsiert dreinzuschauen, auf jeden Fall nicht ernst, aber auch nicht allzu interessiert. Am besten, ich tue, als ob sie mir ein Kompliment zuflüstere, etwas Harmloseres gebe es in ihrem Alter nicht. Sie erwarte mich morgen Nachmittag um drei in ihrem Haus in Hietzing. Dann lachte sie spitz auf — ich lachte ebenfalls, als hätte sie mir, der ich halb so alt war wie sie, tatsächlich ein Kompliment gemacht — und raunte mir ihre Adresse zu.
Ich war nur für dieses Abendessen von Vorarlberg nach Wien gefahren. Frau Perleman-Jacob war eine zu bekannte Persönlichkeit, um abzulehnen, eine der bedeutendsten europäischen Architektinnen des 20. Jahrhunderts. Berühmtheit erlangt hatte sie, als sie in den Fünfzigerjahren in Frankfurt, Brüssel und in den Siebzigerjahren auch in Amerika Siedlungen für Arbeiter geplant und gebaut hatte, die — ich zitiere aus der Einladung des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins — »Schönheit und Funktion in unvergleichlicher Weise miteinander verbinden und dabei so kostengünstig waren, dass die Arbeiterfamilien es sich leisten konnten, sie eines Tages zu besitzen, weil Frau Professor Perleman-Jacob zugleich ein System errechnet hatte, das erlaubte, dass Mietzahlungen nach einigen Jahren in Vorauszahlungen auf Eigentum umgewandelt werden konnten«. Ein Freund, auch er Architekt, dem ich von der Einladung erzählte, hatte ausgerufen: »Was, die lebt noch?« Und hatte gleich gefragt: »Was hast du getan, dass sie dich bei ihrem Geburtstag bei sich haben will?« Darauf konnte ich ihm keine Antwort geben, die mir selbst triftig geklungen hätte.
Ich möchte zu Beginn meines Berichts ein paar Daten nennen: Anouk Perleman-Jacob wurde 1908 in Sankt Petersburg in Russland geboren und lebte dort bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr. Ihre Mutter, Maria Perleman, war Ornithologin und arbeitete als Assistentin von Sergei Buturlin, dem über Russland hinaus bekannten Wissenschaftler. Der Vater, Michail Jacob, war bis zur Ausreise der Familie Professor an der Universität Sankt Petersburg, als junger Mann hatte er zu der Gruppe von Architekten gehört, unter deren Leitung die berühmte Große Choral-Synagoge geplant und gebaut worden war. Mutter und Vater genossen in intellektuellen Kreisen der Stadt großes Ansehen, beide sympathisierten lange mit den Bolschewiki. Vor allem, weil sie anprangerten, wie unter dem Zaren die Juden behandelt wurden. Nach dem Tod ihrer Eltern — sie waren im Exil in Berlin 1931 gemeinsam aus dem Leben geschieden — nahm Anouk den Namen sowohl ihres Vaters als auch den Geburtsnamen ihrer Mutter an. Auch um, wie sie sich ausdrückte, ein Zeichen des Protests zu setzen gegen die Tradition, die Kinder immer und allein nach dem Vater zu benennen. — Das war übrigens das Erste, was sie mir erzählte, da hatte ich noch gar nicht ihr gegenüber Platz genommen.
»Mein Ehemann ist vor dreißig Jahren gestorben. Wir waren zwanzig Jahre verheiratet. Es hat ihn nicht gestört, dass ich ohne seinen Namen neben ihm existierte. Ebenso wenig, wie es mich gestört hat, dass er hieß, wie er eben hieß. Wir hatten nicht viel gemeinsam, zu wenig, um einen gemeinsamen Namen zu rechtfertigen.«
Wir saßen im Wohnzimmer einer sachlich eingerichteten Villa — bei einem meiner späteren Besuche führte mich Frau Perleman-Jacob durch das Haus —, wir tranken Bier, und sie rauchte. Sie habe vor drei Jahren wieder damit angefangen und hoffe nun, die Zigaretten brächten sie schneller hin zum Tod.
Und dann teilte sie mir den wenig schmeichelhaften Grund mit, warum sie gerade mich »ausgesucht« habe.
»Ich habe mich über Sie erkundigt. Sie haben einen guten Ruf als Schriftsteller, aber auch einen etwas windigen. Ich weiß, dass Sie Dinge erfinden und dann behaupten, sie seien wahr. Jeder wisse das, hat man mir gesagt, aber immer wieder gelinge es Ihnen, Ihre Leser und Zuhörer hinters Licht zu führen. Deshalb glaube man Ihnen oftmals nicht, wenn Sie die Wahrheit schreiben, und glaube Ihnen, wenn Sie schummeln. Das habe ich mir sagen lassen. Stimmt das?«
Und kam, ohne meine Antwort abzuwarten, zu ihrer Sache: »Sie sollen nicht meine Biografie schreiben, die ist bereits geschrieben worden. Zwei sogar. Eine auf Deutsch, eine auf Russisch. Beide nicht besonders. Das jedenfalls meint Alice Winegard. Ich habe weder die eine noch die andere gelesen. Alice haben Sie kennengelernt, sie saß bei uns am Tisch. Ist Ihnen aufgefallen, dass sie keine Augenbrauen hat? Wie das Looshaus am Michaelerplatz. Sie arbeitet zusammen mit einer Kollegin an der dritten Biografie, die soll aber eine Monografie werden, eine Werkschau. Das heißt, Alice selbst schreibt nicht, sie gibt lediglich Auskunft, sie weiß alles über meine Arbeit. Aber nicht alles über mich. Was niemand weiß, das sollen Sie schreiben, ein Schriftsteller, dem man nicht glaubt, was er schreibt.« — Das aber sei nicht ihr Problem, sondern meines. — »Gesagt werden soll es. Und wenn es keiner glaubt, umso besser. Aber erzählt werden soll es.«
Ich fragte nicht weiter. Ich dachte, wenn ich frage, mildere ich meinen schlechten Ruf. Ich wolle darüber nachdenken.
»Bitte«, sagte sie, »denken Sie nicht zu lange darüber nach. Die Zigaretten wirken bereits.«
Ich telefonierte mit meiner Frau. Monika war empört. Alter schütze offenbar nicht vor unzumutbarem Verhalten. Ob wir wenigstens über Geld gesprochen hätten. Hatten wir nicht.
»Also sag...










